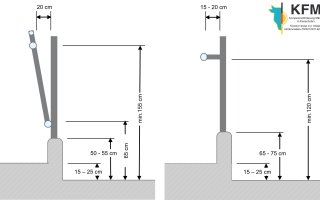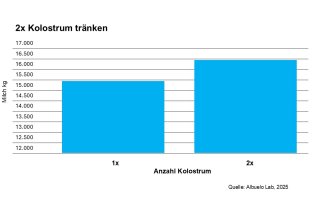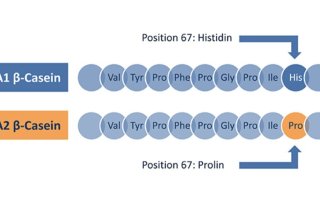Bildung fördert Rentabilität
Die Umfrage vom Unternehmerverband Atameken und auch die KFM-Auswertungen bestätigen es: die Entwicklung der Landwirtschaft, besonders die der tierhaltenden Betriebe leidet unter einem deutlich spürbaren Mangel an Fachkräften.
Neun Referenten setzten sich kürzlich in einer Konferenz am Rand der KazAgro intensiv mit den damit zusammenhängenden Fragestellungen auseinander. Eine große Hilfe für die Personalfindung sieht Yerbolat Karmambayev (Logos Grain LPP) in der Automatisierung und Digitalisierung sowie in der Schaffung „sauberer“ Arbeitsplätze.
Nach Auffassung von Uwe Weddige (KFM) kann nur eine gute Ausbildung in Kombination mit regelmäßigen Weiterbildungsmaßnahmen eine fehlerarme Arbeitserledigung und fachgerechte Entscheidungen bewirken. „Auf diese Weise wird die Motivation gestärkt, die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihrem Arbeitsplatz und die Produktivität und auch die Rentabilität nehmen spürbar zu“, so der KFM-Projektleiter.
Diese Auffassung bestätigten Alexander Zharov (DEULA Nienburg) und Aram Aristakesyan von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Beide Einrichtungen bieten für künftige kasachische Fachkräfte ein großes Portfolio an Ausbildungsmaßnahmen in Kasachstan und in Deutschland an. Besonders wichtig ist den beiden Bildungsexperten die intensive Verknüpfung von theoretischem und praktischem Wissen.
In seiner Moderation und der Zusammenfassung unterstrich Maksim Sutula (NANOZ) die Bedeutung von Aus- und Weiterbildung für die Erreichung der Produktivitätsziele: „nur dieser Weg ermöglicht es der Republik Kasachstan, die Innovationskraft und die internationale Wettbewerbsfähigkeit seiner Landwirtschaft zu sichern!“
Uwe Weddige
Foto: © KFM 2025