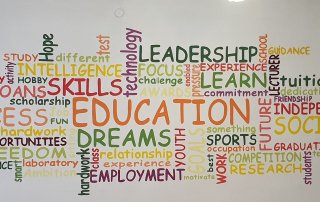Milchaustauscher wiegen, nicht messen
Milchaustauscher (MAT) sollte eine Vollmilch möglichst gut ersetzen. Dafür muss die Pulvermenge passen. Wer nach Volumen statt nach Gewicht dosiert, liegt oft falsch.
Mit hochwertigem MAT mit 50 % Magermilchanteil lässt sich eine immer gleiche Konzentration der Inhaltsstoffe sicherstellen. Voraussetzung ist aber korrektes Anmischen.
Die Beratungspraxis zeigt, dass viele Betriebe mit hohen Abweichungen Probleme mit Frühdurchfall haben. Anders als vermutet, belasten und übersäuern hohe Konzentrationen an Fett, Eiweiß und Zucker die Verdauung der Kälber. Bei anschließendem Durchfall fehlt ihnen schnell ausreichend Flüssigkeit. Wichtig ist es daher, auf die Herstellerangaben zu achten.
Nur die Kontrolle der fertigen Mischung mit einem Refraktometer gibt Sicherheit. Mit Hilfe der Brix-Werte und einer Tabelle lässt sich die Trockenmasse (TM) ableiten. Nach unseren Erfahrungen entspricht ein Brixwert von 10,3 einer MAT-Konzentration von 120g/l, während 12,9 Brix 140 g/l entsprechen und 14,7 auf 160 g/l hinweisen.
Erfolgreiche Landwirte wiegen den MAT immer ab: Wenn man Pulver oben aus dem Sack nimmt, ist der Messbecher im Vergleich zu Pulver, das sich ganz unten im Sack befindet, deutlich leichter. Außerdem hängt für das Umrechnen der jeweils nötigen Wasser- und MAT-Menge eine Anmischtabelle neben der Waage.
Uwe Weddige Foto © KFM