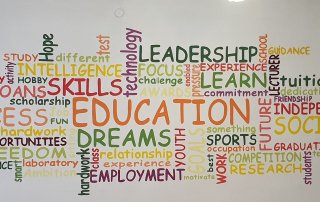Kryptosporidien
Neugeborene Kälber können bereits in der Abkalbebox die Parasiten-Eier (Oozysten) der Kryptosporidien oral aufnehmen. Schon ab dem 3. Lebenstag entstehen im Dünndarm neue Oozysten, die einerseits eine Infektion im Kalb auslösen und andererseits mit dem Kot ausgeschieden werden und im Anschluss andere Kälber infizieren.
Oozysten sind sehr widerstandsfähig, sie überleben monatelang bei Temperaturen zwischen -17 und +60 °C. Eine schlechte Kolostrumversorgung, mangelnde Hygiene, kaltes und feuchtes Wetter fördern in Kombination mit einem geschwächtem Immunsystem des Kalbes, einem hohen Erregerdruck und Co-Infektionen wie Rota-Corona und E.coli die Infektion.
Ist ein Kalb infiziert, helfen Elektrolyte und Milch in Kombination mit einem Schmerzmittel sowie Vitamin E, Selen und Vitamin B12. Zur Vermeidung von Sekundärinfektionen eignet sich Paromomycin. Zeigt das Kalb keinen Saugreflex, hilft eine Infusion mit Elektrolyte und Natriumhydrogencarbonat. Der Einsatz des Wirkstoffes Halofuginon (z. B. Halocur) ist dagegen nur prophylaktisch möglich. Achtung: Eine Überdosierung kann toxisch sein.
Als Prävention sollte ein Kalb innerhalb von zwei Stunden nach der Geburt vier Liter Kolostrum trinken. Studien bestätigen sogar, dass Kälber mit einem hohen Immunglobulin-Gehalt im Blut eine signifikant geringere Oozysten-Ausscheidung und Durchfalldauer haben.
Eine penible Reinigung und Desinfektion der Kälberboxen ist unverzichtbar. Betonflächen und Arbeitsgeräte im Kälber- und Kalbestall sind besenrein zu säubern, mit einem alkalischen Reiniger einzuschäumen und dem Hochdruckreiniger zu reinigen. Anschließend abtrocknen lassen und mit einer 4 %igen Neopredisan-Lösung desinfizieren. Im Idealfall steht die Kälberbox anschließend fünf bis sieben Tage leer.
Eine weitere Prophylaxemaßnahme ist die Impfung. Bewährt haben sich je eine Injektion zum Trockenstellen in Kombination mit einer zweiten Injektion nach drei Wochen. Dabei ist eine Kombination mit einer weiteren Mutterschutzimpfung (z. B. Rotavec-Corona) problemlos möglich.
Die Impfung kann aber keine sorgfältige Kolostrumversorgung und Hygienemaßnahmen ersetzen.
Uwe Weddige
Foto: KFM